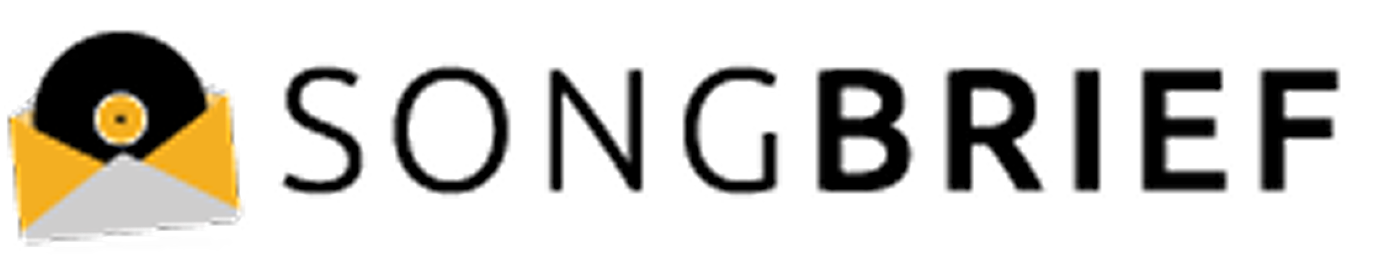TROMMELSCHLÄGE FÜRS AMERIKANISCHE GEWISSEN
„Pfad der Tränen“: Was zunächst wie der Titel einer kitschigen Schnulze von Christian Anders oder eines neuen ZDF-Hauptabendfilms nach einem Buch von Rosamunde Pilcher anmutet, deckt wie kaum eine anderer Begriff die Versündigung der Vereinigten Staaten an den Indianern zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf. Der „Trail of tears“ bezog sich dabei konkret auf die Zwangsumsiedlung der Cherokee-Indianer nach Oklahoma im Jahr 1838. Schon zuvor mussten die Völker der Choctaw, Muskogee und Chickasaw ihre Heimat im Südosten des Landes verlassen, zuletzt betraf es auch die Seminolen, die sich erbitterte Kämpfe mit den weißen Eroberern um den fruchtbaren Boden lieferten. Ein zweifellos pechschwarzes Kapitel der amerikanischen Geschichte – bis zum heutigen Tage lässt eine Entschuldigung von höchster Stelle auf sich warten.
Also musste mal wieder die Kunst das ansprechen, wozu die Politik offensichtlich nicht in der Lage war. „Indian Reservation“ ist ein solches Beispiel hierfür – ein klassischer Protestsong, der schonungslos offenbart, mit welcher Rücksichtslosigkeit die indianische Kultur der Zerstörung preisgegeben wurde: „They took the whole Cherokee nation, and put us on this reservation, they took away our way of life, the tomahawk and the bow and knife.“ Für diese Aussage braucht es gerade einmal charakteristische Trommelschläge, zwei sich abwechselnde Akkorde und die Rufe an das Gewissen einer modernen Weltmacht: „Cherokee people, Cherokee tribe! So proud you lived, so proud you died!“
Das Original stammt tatsächlich von einem Cherokee-Abkömmling namens Marvin Rainwater, der 1959 das Lied unter dem Titel „The Pale Faced Indian“ aufnahm. Der Komponist John D. Loudermilk veröffentlichte es 1965 auf einem seiner Alben und trat damit eine regelrechte Welle an Coverversionen los – einer der wahren Spezialisten des gepflegten Coversongs hieß Don Fardon, ein britischer Popsänger, der sich mit der Anklagenummer erfolgreich die One-Hit-Wonder-Prämie abholte. Anders jedoch als die grässliche Discovariation des Orlando Riva Sounds etwa 8 Jahre später hielt sich Fardon an der zurückhaltenden Rhythmus-Monotonie des Originals und ließ nur ein paar dezente Bläser zu, die den Ursprungs-Charakter von „Indian Reservation“ beibehielten.
Große Songs können auch durch Remixes und Coverversionen nicht wirklich zerstört werden (gut, außer es sind Mark´Oh oder Pitbull am Werk). Und die Messages der größten Songs bleiben ebenfalls ewig enthalten. So wie diese: „And some day when the world has learned, Cherokee Indian will return, will return, will return…“ (Weitere Infos zum Thema)
Urteil: Es sind Text und Grundtenor von „Indian Reservation“, die sich weit über den Künstler erheben und diesen geradezu nebensächlich machen. 8 von 10 Punkten
Jan